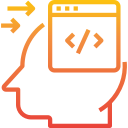Verborgene Kosten und Risiken erkennen
Anbieterbindung kann bei Low‑Code hoch sein: Datenmodelle, Logik und Integrationen sind tief im Ökosystem verankert. Prüfen Sie Exportpfade, Migrationskosten und Vertragsklauseln. Auch bei klassischer Entwicklung entstehen Bindungen – etwa durch seltene Bibliotheken – jedoch oft mit mehr Gestaltungsfreiheit.
Verborgene Kosten und Risiken erkennen
Was heute mit wenigen Klicks entsteht, kann morgen anspruchsvolle Erweiterungen verlangen. Custom‑Code, Workarounds und Integrationslogik addieren Komplexität. In traditioneller Entwicklung entstehen diese Kosten früher sichtbar, dafür sind Architekturentscheidungen gezielter planbar und langfristige Wartbarkeit besser steuerbar.